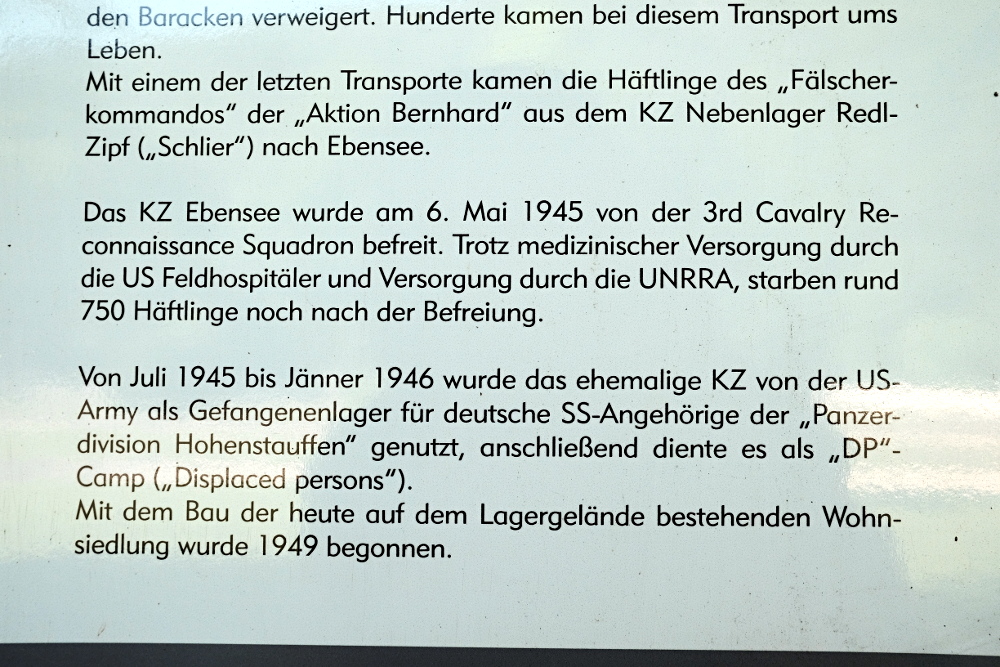Arvi aus Kruja nimmt uns in seinem Wagen mit ins Restaurant. Es gehört ihm, genauso wie der Campingplatz auf dem wir heute Nacht stehen. Seine helfenden Hände sind Guido und Sandra aus Berlin, die im April hier gestrandet sind und ihm beim Aufbau des Platzes unterstützen. Arvis Familie flüchtete bereits in der Zeit des Kommunismus in die Schweiz. Er wuchs dort auf und besuchte eine Waldorfschule. Nach einem köstlichen Essen in seinem Lokal setzt er sich zu uns und wir unterhalten uns über Politik. Deutschland, Europa und die Zukunft Albaniens sind Themen, die wir anreisen. Bei der Frage des Beitritts Albaniens in die EU sind wir einer Meinung. Er wird das Land nachhaltig verändern. Nicht zum Besseren. Die Straßen werden wohl weiter ausgebaut werden, aber für einen Großteil der Menschen wird sich nichts ändern. Die sozialen Gegensätze sind jetzt schon extrem und nach dem Beitritt Albaniens wird die gleiche „kriminelle“ Elite die heute die Drogengeschäfte kontrolliert, die Gelder aus Brüssel abschöpfen. Durch den zu erwartenden „Geiz-ist-geil-Tourismus“ wird das Herz der Albaner auf der Strecke bleiben. O-Ton Arvi: „Seit froh, daß ihr jetzt hier seit, so habt ihr Albanien noch mal vor dieser großen Veränderung gesehen“.




Pogradec liegt am Ohridsee und ist eine Stadt mit ca. 21.000 Einwohnern. Die Stadt wirkt aufgeräumt und herausgeputzt. In Verbindung mit der Lage am See, könnte man meinen, in einer Stadt am Gardasee zu sein. Der See selbst ist relativ klein und liegt zum größten Teil auf nordmazedonischem Territorium. Die berechtigte Frage von Arvi: „Was wollt ihr an diesem See? Ihr habt doch den Bodensee“, ergibt für uns erst einen Sinn, nachdem wir ihn selbst gesehen und das einheimische Touristentreiben erlebt haben. Arvis Frage war zumindest berechtigt. Wir fahren nach Korca und bummeln durch die Stadt. Gemüsestände überall. Wir schlagen zu und kommen mit mehreren Tüten Salat und Gemüse so günstig davon, daß wir zwischen Wundern und Schämen hin und hergerissen sind. Wir kaufen zwei Forellen, die vor unseren Augen ausgenommen werden, sie sind also frisch, der Preis von 400 Lek angemessen. Die Händlerin hätte sie uns auf unseren Wunsch hin im Laden gegrillt, doch wir wollen sie in unserem Camper im Topf dämpfen. Die Stadt ist quirlig und wird im Reiseführer auch als das „Paris Albaniens“ bezeichnet. Und hier treffen wir die ersten Menschen, die uns um Geld anbetteln.








Berat, die „Stadt der tausend Fenster“ ist eine touristische Sehenswürdigkeit in Albanien, auch für die Einheimischen. So ganz können wir das nicht nachvollziehen. Sicher, die Stadt ist malerisch an einer Engstelle des Osum-Flusses gelegen. Der Ort wurde bereits 2600 v. Chr. besiedelt und spielte in der Geschichte des Landes unter verschiedenen Herrschaftseinflüssen immer wieder eine wichtige Rolle. Die moderne Fußgängerzone ist gesäumt von Restaurants und Bars. Die Menschen leben vor allem vom Tourismus und in der Umgebung von der Landwirtschaft.